Dr. Jens Weidmann und
Präsident der Deutschen Bundesbank hielt anlässlich des 18.
Kolloquiums des Instituts für bankhistorische Forschung (IBF)
Papiergeld – Staatsfinanzierung – Inflation, eine Begrüßungsrede.
Traf Goethe ein Kernproblem der Geldpolitik.
Hier ein Auszug dieser Rede:
Ich
möchte mit einer Frage beginnen, die auf den ersten Blick trivial,
damit aber erfahrungsgemäß besonders schwierig ist: Was ist
eigentlich Geld? Eine prägnante Antwort aus ökonomischer Sicht
lautet: Geld ist, was Geldfunktionen erfüllt.
Da
Geld über seine Funktionen definiert wird, sind ganz verschiedene
Dinge grundsätzlich geeignet, als Geld zu fungieren, solange sie als
Tauschmittel, als Zahlungsmittel und als Wertaufbewahrungsmittel
genutzt werden können.
In
einigen Ländern wurden früher z. B. Muscheln als Geld verwendet,
gleiches gilt für Felle, Salze oder Perlen. Auch Nutzvieh konnte als
Geld dienen – das lateinische Wort für Vieh lautet „pecus“,
von dem sich „pecunia“ für Geld ableitet.
Über
die längsten Phasen der Menschheitsgeschichte dienten also konkrete
Gegenstände als Geld, wir sprechen daher von Warengeld. Insbesondere
genossen und genießen edle und seltene Metalle – an erster Stelle
Gold –wegen ihrer angenommenen Werthaltigkeit hohes Vertrauen.
Gold
ist somit gewissermaßen der zeitlose Klassiker in seiner Funktion
als Tausch-, Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel. „Nach
Golde drängt, am Golde hängt doch alles“,
lässt Goethe Margarete im Faust I sagen.
Jenes
Geld jedoch, welches wir in Form von Banknoten und Münzen bei uns
tragen, hat mit Warengeld nichts mehr zu tun. Die Rückbindung an
Goldbestände gibt es nicht mehr, seit im Jahr 1971 die Goldbindung
des US-Dollar aufgehoben wurde.
In
Kurzform: Heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt.
Banknoten sind bedrucktes Papier – die Kenner unter Ihnen wissen,
dass es sich im Fall des Euro eigentlich um Baumwolle handelt –,
Münzen sind geprägtes Metall.
Dass
Banknoten und Münzen im täglichen Leben als Zahlungsmittel
akzeptiert werden, hat zwar auch damit zu tun, dass sie alleiniges
gesetzliches Zahlungsmittel sind. Letztlich fußt die Annahme von
Papiergeld jedoch primär auf dem Vertrauen der Bevölkerung, mit dem
erhaltenen Papiergeld selbst auch wieder Käufe tätigen zu können.
Geld
ist in diesem Sinne eine gesellschaftliche Konvention – es hat
keinen eigenständigen Wert, der der Nutzung vorgelagert ist, sondern
sein Wert entsteht erst durch den ständigen Austausch und den
Gebrauch als Geld. Diese Erkenntnis, dass Vertrauen zentral, ja
konstitutiv für die Geldeigenschaft ist, ist übrigens schon sehr
alt. Aristoteles hat sie bereits im 4. Jahrhundert vor Christus in
seiner "Politik" und der "Nikomachischen Ethik"
herausgearbeitet.
Gerade
in jüngster Zeit stellen sich viele Bürger die Frage nach der
Herkunft des Geldes: Woher nehmen denn die Zentralbanken eigentlich
das viele Geld, das sie brauchen, um dem Bankensystem im Rahmen
geldpolitischer Operationen Kredite in Billionenhöhe zu geben oder
anderes zu kaufen? Weshalb heißt es in diesem Zusammenhang
regelmäßig, dass die finanzielle Feuerkraft der Notenbanken
grundsätzlich grenzenlos sei?
Notenbanken
schaffen Geld, indem sie Geschäftsbanken gegen Sicherheiten Kredite
gewähren oder ihnen Aktiva wie zum Beispiel Anleihen abkaufen. Die
Finanzkraft einer Notenbank ist dabei prinzipiell unbegrenzt, da sich
eine Notenbank das Geld, das sie vergibt oder mit dem sie bezahlt
vorher nicht etwa beschaffen muss, sondern es quasi aus dem Nichts
erschaffen kann.
Das
Drucken neuen Geldes ist hierfür ein passendes Bild, ökonomisch
gesehen ist die Notenpresse jedoch gar nicht nötig, da sich die
Geldschöpfung primär in der Bilanz der Notenbank, auf ihren Konten,
widerspiegelt.
Wie
kommt nun aber beim Thema der beschriebenen Geldschöpfung Johann
Wolfgang von Goethe ins Spiel? Warum habe ich den Bogen also etwas
weiter gespannt?
Zur
Erinnerung sei hier kurz an die Geldschöpfungsszene im ersten Akt
von Faust II erinnert. Mephisto, als Narr verkleidet, spricht mit dem
von akuten Geldnöten geplagten Kaiser und konstatiert:
„Wo
fehlt’s nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dies, dem das, hier
aber fehlt das Geld.“
Der
Kaiser erwidert schließlich auf Mephistos geschickten
Überredungsversuch:
„Ich
habe satt das ewige Wie und Wenn; Es fehlt an Geld, nun gut, so
schaff’ es denn.“
Mephisto
antwortet darauf:
„Ich
schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr.“
Er
bringt den Kaiser im Trubel des nächtlichen Maskenballs dazu, eine
Urkunde zu unterschreiben, die Mephisto über Nacht vervielfältigen
und anschließend als Papiergeld verbreiten lässt.
Die
Beteiligten sind vom anfänglichen Erfolg dieser Maßnahme ganz
angetan. So verkündet der Kanzler voller Freude:
„So
hört und schaut das schicksalsschwere Blatt – (gemeint
ist das geschaffene Papiergeld) –
das
alles Weh in Wohl verwandelt hat.“
Er
liest: ´Zu
wissen sei es jedem, der’s begehrt: Der Zettel hier ist tausend
Kronen wert.´“
Mephisto
facht die Freude noch weiter an, indem er kurze Zeit später sagt:
„ Ein
solch Papier, an Gold und Perlen statt,
Ist
so bequem, man weiß doch, was manhat;
Man
braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen,
Kann
sich nach Lust in Lieb’ und Wein berauschen.“
Die
Beteiligten sind so beglückt über die vermeintliche Wohltat, dass
sie gar nicht ahnen, dass ihnen die Entwicklung aus den Händen
gleiten wird:
Zwar
kann sich der Staat im Faust II in einem ersten Schritt seiner
Schulden entledigen, während die private Konsumnachfrage stark
steigt und einen Aufschwung befeuert. Im weiteren Verlauf artet das
Treiben jedoch in Inflation aus und das Geldwesen wird infolge der
rapiden Geldentwertung zerstört.
Es ist
beeindruckend, dass und wie Goethe den potenziell gefährlichen
Zusammenhang von Papiergeldschöpfung, Staatsfinanzierung und
Inflation – und somit ein Kernproblem ungedeckter Währungsordnungen
– in Faust II beleuchtet. Dies gilt gerade deshalb, da man Faust
und Goethe in der Regel nicht direkt mit ökonomischen Zusammenhängen
assoziiert, schon gar nicht mit solch zentralen geldpolitischen
Spannungsfeldern.
Dass
sich Faust jedoch sehr wohl ökonomisch deuten lässt, hat unter
anderem Prof. Adolf Hüttl gezeigt. Er ist ehemaliger Vizepräsident
der damaligen Landeszentralbank in Hessen und zu meiner großen
Freude heute hier anwesend. Bereits 1965 schrieb er im
Mitarbeiter-Magazin der Bundesbank einen sehr erkenntnisreichen Text
unter der Überschrift „Das Geld in Goethes Faust II“.
Der
seinerzeit in Sankt Gallen lehrende Prof. Hans Christoph Binswanger –
zu meiner Freude heute ebenso anwesend – ging ähnlich vor und
legte Mitte der 80er-Jahre ein Buch mit dem Titel „Geld und Magie –
Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust“
vor.
Die
zentrale These Binswangers lautet, dass Goethe die moderne Wirtschaft
mit ihrer Papiergeldschöpfung als eine Fortsetzung der Alchemie mit
anderen Mitteln darstelle. Während die klassischen Alchemisten
versuchten, aus Blei Gold zu machen, werde in der modernen Wirtschaft
Papier zu Geld gemacht.
In der
Tat dürfte der Umstand, dass Notenbanken quasi aus dem Nichts Geld
schaffen können, vielen Beobachtern als etwas Überraschendes,
Seltsames, vielleicht sogar Mystisches, Traumhaftes – oder auch
Alptraumhaftes – vorkommen.
Denn
wenn Notenbanken potenziell unbegrenzt Geld quasi aus dem Nichts
schaffen können, wie kann dann sichergestellt werden, dass Geld
ausreichend knapp und somit werthaltig bleibt? Ist bei der
Möglichkeit, Geld mehr oder weniger frei zu schaffen, die Versuchung
nicht sehr groß, dieses Instrument zu missbrauchen und sich
kurzfristig zusätzliche Spielräume zu schaffen, auch wenn damit
langfristiger Schaden sehr wahrscheinlich ist?
Ja,
diese Versuchung besteht sehr wohl, und viele sind ihr in der
Geschichte des Geldwesens bereits erlegen. Schaut man in der Historie
zurück, so wurden staatliche Notenbanken früher oft gerade deshalb
geschaffen, um den Regenten möglichst freien Zugriff auf scheinbar
unbegrenzte Finanzmittel zu geben.
Durch
den staatlichen Zugriff auf die Notenbank in Verbindung mit großem
staatlichem Finanzbedarf wurde die Geldmenge jedoch häufig zu stark
ausgeweitet, das Ergebnis war Geldentwertung durch Inflation.
Im
Licht dieser Erfahrung wurden Zentralbanken in den vergangenen
Jahrzehnten gerade deshalb als unabhängige Institutionen
geschaffen und auf das Sichern des Geldwertes verpflichtet, um
explizit die staatliche Vereinnahmung der Geldpolitik zu verhindern.
Die
Unabhängigkeit der Notenbanken ist ein außergewöhnliches Privileg
– ein Selbstzweck ist sie jedoch nicht. Vielmehr dient sie im Kern
dazu, glaubwürdig sicherzustellen, dass sich die Geldpolitik
ungehindert darauf konzentrieren kann, den Geldwert stabil zu halten.
Geldpolitische
Unabhängigkeit und ein gut funktionierender, auf Geldwertstabilität
ausgerichteter Kompass der geldpolitischen Entscheidungsträger sind
notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Voraussetzungen
dafür, die Kaufkraft des Geldes und damit das Vertrauen der Menschen
zu bewahren.
Für
das Vertrauen ist aber wichtig, dass sich Notenbanker, die ein
öffentliches Gut verwalten – stabiles Geld – auch öffentlich
rechtfertigen. Der beste Schutz gegen die Versuchungen in der
Geldpolitik ist eine aufgeklärte und stabilitätsorientierte
Gesellschaft.
Und
HIER können Sie die gesamte Begrüßungsrede von Dr. Jens
Weidmann nachlesen bei der Deutschen Bundesbank.



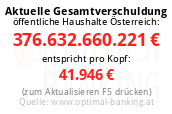










Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen